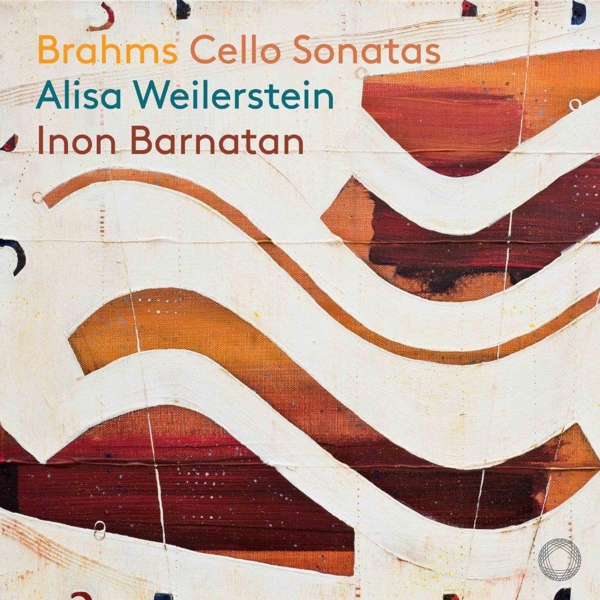Immer mehr Klassik-Stars verlegen ihren Wohnsitz nach Berlin. Auch Alisa Weilerstein bestätigt zu Beginn des Interviews, inzwischen eine Wohnung im Prenzlauer Berg zu besitzen. Das Gespräch hätte also in der Nachbarschaft des Autors stattfinden können – wären da nicht die zahlreichen Konzertverpflichtungen der Cellistin, die sich nun am Telefon aus Norwegen meldet.
Frau Weilerstein, gelegentlich spielen Sie unter dem Dirigat Ihres Bruders Joshua oder auch unter Ihrem Ehemann Rafael Payare. Was ist das Besondere am Musizieren mit Familienmitgliedern?
Wir haben nicht nur auf persönlicher Ebene ein sehr enges Verhältnis, sondern auch auf musikalischer. Wir können sehr gut voneinander lernen. Und wenn ich mit ihnen spiele, fühle ich mich sehr sicher, dafür braucht es immer ein tiefes Vertrauen zwischen Musikern.
Und ist es schwieriger, mit anderen Musikern so ein Vertrauen aufzubauen?
Es gibt natürlich wunderbare Dirigenten, mit denen ich es liebe, zu spielen, bei denen ich auch eine große Freiheit spüre. Aber es ist schon noch etwas Spezielles mit Familienmitgliedern, eben weil es Menschen sind, die dich sehr gut kennen.
Wie verlaufen denn Diskussionen über Musik innerhalb der Familie?
Wenn du mit Familienmitgliedern spielst, gibt es keine Notwendigkeit, irgendetwas zu beschönigen. Man spart sich Nettigkeiten oder Höflichkeiten, die man sonst vielleicht parat hat, gegenüber Kollegen. Das heißt, wenn wir diskutieren, kann das für Außenstehende zum Teil sehr heftig klingen. Doch für uns ist das normal, eben sehr ehrlich.
Sie haben auch Daniel Barenboim in einem Interview so beschrieben, dass seine Worte oft harsch sein können, doch dass er es mit dem betreffenden Musiker nur gut meint.
Daniel Barenboim ist ein Genie, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie viel ich von ihm gelernt habe. Er hat einen besonderen Probenprozess. Und ja, er verschwendet keine Zeit mit Höflichkeiten. Er ist komplett ehrlich und das schätze ich. Auch wenn es in dem Moment sehr intensiv sein kann.
Höflichkeit ist also vielleicht gar nicht hilfreich für das gemeinsame Musizieren …
Es kommt drauf an. Wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die ihre ganze Leidenschaft hineinstecken, kann es sein, dass die Wellen sehr hoch schlagen, weil du ehrlich sagst, was du im Innersten empfindest. Oft sind das die produktivsten Proben. Doch man muss eben erst dort hinkommen und so ein Vertrauen entwickeln, bei dem eine sehr persönliche Bemerkung vom Gegenüber nicht falsch verstanden wird.
Produktivität braucht es auch für eine erfolgreiche Karriere. Haben Sie da in Ihrer eigenen einen bestimmten Moment als den Durchbruch erlebt?
Nein, es gab bei mir nicht dieses Explosionsartige, es geschah viel mehr Schritt für Schritt. Natürlich gibt es Meilensteine, wie zum Beispiel 2010 mein erstes Konzert mit den Berliner Philharmonikern, das im Fernsehen übertragen wurde, auch künstlerisch gesehen war das ein wichtiger Moment. Ebenso die Aufnahme des Elgar-Konzerts mit Daniel Barenboim und der Staatskapelle, das hat viel ausgemacht. Auf der anderen Seite spiele ich aber schon als Solistin, seit ich 14 bin. Bei meinem Debüt mit den New Yorker Philharmonikern war ich erst 24 – aber ich hatte eben schon zehn Jahre Erfahrung hinter mir. Ich habe immer weiter daran gearbeitet, allmählich Beziehungen aufgebaut und die Fühler ausgestreckt. Ich bin dankbar, dass das nicht alles auf einmal passierte, denn so war ich immer noch in der Lage, ein normales Leben zu führen.
Wobei „normal“ bedeutete: Von morgens bis mittags gingen Sie auf die High School, anschließend lernten Sie am Cleveland Institute of Music, bis sechs Uhr abends.
Genau, und ab sechs habe ich dann zu Hause geübt und Hausaufgaben gemacht. Ganz normal. Wissen Sie, ich hatte einen sehr starken familiären Rückhalt, wunderbare Freundschaften, ich hatte ein Leben. Ich war nicht zehn Stunden täglich eingeschlossen in einem Raum wie viele andere Kinder, die ganz jung beginnen. Und alles, was ich gemacht habe, war meine Entscheidung. Ich wurde nie zu etwas gezwungen, ich habe nie Druck erlebt – außer den, den ich mir selbst gemacht habe, weil ich diesen Antrieb gespürt habe, sogar als Kind. Ich habe es meinen Eltern sozusagen sehr leicht gemacht: Sie mussten mich nicht drängen zu üben.
Es gibt unter Eltern ja unterschiedliche Meinungen darüber, ob man ein Kind an eine bestimmte Beschäftigung heranführen oder warten sollte, bis das Kind von selbst Interessen entwickelt. Sie wollten angeblich schon mit vier Cello spielen. Woher kam dieser Wille?
Ich wünschte, ich könnte Ihnen das erklären. Das war einfach sehr intuitiv, ich wusste in dem Alter, dass Cellospielen das ist, was ich machen werde.
Weil Sie zu Hause klassischer Musik ausgesetzt waren?
Vielleicht, aber das wird nicht der einzige Grund gewesen sein, denn viele Menschen, die mit Musik aufwachsen, entwickeln nicht das Verlangen, zu musizieren. Ich weiß, dass ich immer tief bewegt war von Musik – meine früheste Erinnerung ist, wie ich mit meinem Vater eine Schallplatte mit Don Giovanni anhörte. Die Szene des Commendatore mochte ich besonders, was vielleicht komisch ist für ein dreijähriges Mädchen. Aber ich erinnere mich, wie ich meinen Vater bat, die Szene immer wieder von vorne abzuspielen: Die Musik hatte eine kraftvolle Wirkung auf mich. Ich bin mir sicher, dass dieses Erlebnis einer der Gründe war, warum ich selbst Musikerin werden wollte.
Sie erwähnten eben Ihre Aufnahme des Elgar-Konzerts. Die hat Ihnen dann sehr viele Vergleiche mit Jacqueline du Pré eingebracht …
… wodurch ich mich sicher sehr geschmeichelt fühlte, auch weil Jacqueline du Pré wohl die Cellistin ist, die ich wirklich am meisten schätze. Andererseits versuche ich solche Vergleiche nicht zu beachten, weil ich es nicht fair finde, wenn man miteinander verglichen wird: Jeder ist eine individuelle Persönlichkeit, jeder hat seine eigenen Ideen.
Interessant ist doch aber der Aspekt, dass weibliche Interpreten immer mit weiblichen und männliche mit männlichen verglichen werden …
… ja, das finde ich auch ärgerlich, dass das automatisch immer so gemacht wird.
Sie würden auch nicht sagen, dass es dafür eine Grundlage gibt? Dass etwa Cellistinnen in bestimmten Dingen anders klingen als ihre männlichen Kollegen?
Nein. Unterschiede im Klang gibt es nicht, weil wir männlich oder weiblich sind, sondern weil wir verschiedene Individuen sind. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Die Pianistin Alicia de Larroccha hatte einen enormen kraftvollen Klang – dabei war sie eine eher zierliche Person, etwa 1,55 Meter groß, kleine Hände. Man hätte nicht vermutet, dass so eine kleine Person diesen Klang hervorbringen kann.
Nun verlangt das Cellospiel ja auch einiges an Körperkraft.
Aber da geht es nicht darum, wie viel Kraft du hast, sondern wie du sie anwendest. Darüber spreche ich oft, wenn ich unterrichte: Wie man den Körper am effektivsten nutzt, wie man am besten Energie und Körpergewicht verteilt. Dann ist es auch möglich, dass eine kleine Person einen sehr „großen“ Klang produziert. Die Stärke ist im Inneren verborgen, und es kommt nur darauf an, wie man den Körper dazu bringt, sie freizusetzen und zu kanalisieren. Das kann allerdings Jahre dauern, ich selbst arbeite da auch noch an mir.
Bei Ihnen kommt hinzu, dass Sie an Diabetes vom Typ 1 erkrankt sind. Mussten Sie jemals einen Auftritt deswegen absagen?
Nein, noch nie. Weil ich meinen Blutzucker sehr streng kontrolliere. Ich habe Diabetes, seit ich neun Jahre alt bin, und damals habe ich mir geschworen, dass mich das nicht aufhalten wird auf meinem Weg. Es ist natürlich eine große Herausforderung, weil es immer präsent ist, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.
Aber wie gehen Sie bei Konzerten mit der Gefahr der Unterzuckerung um, die einen ja sehr plötzlich heimsuchen kann?
Mir ist es auf der Bühne in den 21 Jahren noch nie passiert. Ich überprüfe vor einem Konzert aber auch ganz genau meine Werte und sorge dafür, dass ich kurz vor dem Auftritt leicht überzuckert bin. Denn die Anstrengung auf der Bühne sorgt dann ganz automatisch dafür, dass der Blutzucker ein wenig sinkt. Das heißt, am Ende des Konzerts ist er wieder beim richtigen Wert.