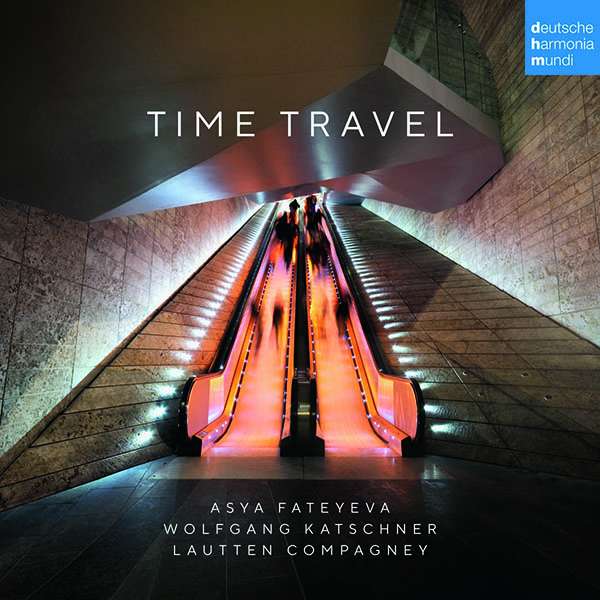Eine ereignisreiche Woche liegt hinter Asya Fateyeva, als sie zum Interview in die concerti-Redaktion kommt: Album-Release, Auftritt bei der Verleihung des Schleswig-Holsteinischen Demokratiepreises an Joachim Gauck, Vorkonzert zum Schleswig-Holstein Musik Festival, das die vor den Toren Hamburgs lebende Saxofonistin zur diesjährigen Artist in Residence auserkoren hat.
Wie haben Sie sich gefühlt, als sich die Festivalveranstalter gemeldet haben mit der Nachricht, dass sie Sie gerne als Porträtkünstlerin hätten?
Asya Fateyeva: Überglücklich! Das Festival hat mir eine Carte blanche gegeben, so dass ich gemeinsam mit Freunden die Dinge ausprobieren kann, die mir am Herzen liegen. Etwa im Quartett mit Drehleier, Vibrafon und Cello oder in barocken Besetzungen mit Harfe und Fagott. Jedes Konzert wird ein Abenteuer für sich, jedes hat einen anderen Schwerpunkt, da kann ich keines hervorheben.
Woher nehmen Sie die Ideen für neue Klangkonstellationen?
Fateyeva: Das Saxofon ist ohne Zweifel sehr beliebt, aber man kennt es meist nur von seiner jazzigen oder poppigen Seite. Ich probiere gerne aus, suche nach einzigartigen, noch nie dagewesenen Kombinationen und bin immer wieder erstaunt, wenn diese funktionieren. Auch in der Zusammenarbeit mit lebenden Komponisten erweitere ich meinen musikalischen Horizont und meine Klangsprache, deswegen liegen mir Uraufführungen so am Herzen. Ich bin süchtig nach dem Erforschen neuer Klangwelten.
Wie wählen Sie die Werke für Bearbeitungen aus?
Fateyeva: Sehr subjektiv. Das, was mir gerade musikalisch gefällt. Natürlich versuche ich, mich klanglich nicht zu wiederholen und eine Balance zwischen verschiedenen Stimmungen zu halten.
Stoßen Sie bei neuen Projekten auf Skepsis bei Ensembles?
Fateyeva: Es ist leider immer Aufklärungsarbeit dabei. Ich muss für mich zunächst das Rätsel lösen, was die Menschen beim Begriff „Saxofon“ im Kopf hören. Oft beschreiben sie seinen Klang nicht aus dem Moment heraus, sondern bedienen Klischees: rauchig, schrill, balladenartig, laut. Das stimmt jedoch nicht immer. Das Saxofon ist so wandlungsfähig wie die menschliche Stimme. Ich wünschte, man würde ihm von Anfang an mit offenen Ohren begegnen.
Wie würden Sie die Beziehung zu Ihrem Instrument beschreiben?
Fateyeva: Spannend und frisch, je nachdem, in welcher Phase ich mich gerade befinde. Wir sind eine Instrumentenfamilie mit sieben Mitgliedern, vom Sopranino bis zum Kontrabass, die auf einer großen Entdeckungsreise ist. Wir wachsen zusammen, werden gemeinsam älter und reifer. Wenn wir am Ende alle im Consort zusammenspielen, klingt es wie eine Orgel. Das ist wunderbar.
Sie wurden in der französischen Saxofonschule von Jean-Denis Michat ausgebildet. Was unterscheidet diese von anderen?
Fateyeva: Ich würde nicht mehr von einer Schule sprechen, denn inzwischen vermischen sich die Traditionen stark. Vielmehr prägt jede Persönlichkeit den eigenen Weg. Jean-Denis ist auch Komponist und hat als solcher in mir die Kombination aus ausdrucksvollem Spiel, Grenzüberschreitungen und dem Finden der eigenen künstlerischen Stimme gefördert. Als Saxofonist sucht man seinen Platz in der Klassik, den es aber nicht von Haus aus gibt. Es gibt keine feste Stelle im Orchester. Meine Entwicklung war also die aus dem Standardrepertoire heraus und hinein in verschiedene Epochen. Ich will zeigen, wie gut das funktioniert und wie natürlich sich das anfühlen würde, wäre das Instrument eben ein bisschen älter.
Adolphe Sax hat es 1840 inmitten der Romantik erfunden. Woran liegt es, dass doch vergleichsweise wenig Komponisten dafür geschrieben haben?
Fateyeva: Es braucht ein paar Jahrzehnte, bis sich Traditionen und Methoden gebildet, Lehrer und Schüler gefunden haben. Das hat das Saxofon eigentlich gut gemacht. Sein Erfinder war an der Pariser Oper tätig, so dass es damals schon im Orchester präsent war. Er hatte zudem eine eigene Klasse am Konservatorium, die jedoch nach einem verlorenen Krieg aus Geldmangel geschlossen wurde. Über sechzig Jahre fand keine richtige Hochschulausbildung statt. Als dann mit Marcel Mule die Tradition gerade neu auflebte, haben die Nazis das Instrument in eine so einseitige, schlimme und schmutzige Ecke gedrängt.
Ganz anders erlebt man es auf Ihrem Album „To The Muse“, anlässlich dessen Vorstellung Sie gesagt haben: „Mein Instrument hat immer den Wunsch zu wandern.“ Wohin begleiten Sie es?
Fateyeva: Das ist eine schöne Erfahrung, denn dazu habe ich wie eingangs schon erwähnt ein Ensemble mit Drehleier, Cello und Vibrafon gegründet. Wir entdecken Melodien von Troubadouren, die mit Text und in Neumen notiert, aber ohne Rhythmus und Harmonien überliefert wurden. Daraus die passende Musik zu machen, Stimmungen zu schaffen und auch zu improvisieren, das ist wirklich eine Reise. So ein bisschen rauszugehen, mehr zu improvisieren, das habe ich mein Leben lang vermisst. Wir erforschen unser europäisches Kulturgut, das ist wohltuend.
Was geben Sie Ihren Studenten in Lübeck und Hamburg mit?
Fateyeva: Ich versuche, ihre Persönlichkeit herauszukitzeln und ermuntere sie dazu, sofort eigene kreative Projekte auf die Beine zu stellen, denn als Saxofonist ist man immer selbstständig. In Hamburg erlebe ich besonders den Blickwinkel von Jazzstudenten. Da muss ich häufig unsere Traditionen in der Klassik hinterfragen. Zum Beispiel wieso wir neue Stücke nicht von Aufnahmen und nach Gehör erlernen, sondern direkt aus der Partitur. Ich denke, das ist wichtig, um dem Komponisten und seinem Werk näherzukommen und mir so die Freiheit für meine eigene Interpretation zu bewahren.
Was bedeutet Heimat für Sie?
Fateyeva: Sehr schwierig. Ich habe glücklichste Erinnerungen an meine Kindheit auf der Krim mit Sonne, Meer und Musik. Es ist furchtbar zu sehen, wie diese gerade zerstört wird. Ich lebe seit zwanzig Jahren in Deutschland, das ist eine wirklich lange Zeit. Zu Hause fühle ich mich absolut hier. Ich weiß nicht: Kann man seine Heimat wechseln? Musik schützt mich auf jeden Fall. Mit ihr kann ich in jedem Land sozusagen eine Oase installieren. Global zu denken hilft auch, aus der eigenen Nische herauszukommen. Wir sind alle Menschen. Der Austausch mit anderen gibt ein sicheres Gefühl. Und die Hoffnung, dass wir uns alle verstehen können. Zumindest musikalisch.
Maria Callas soll Ihr Idol sein.
Fateyeva: Ja, schon als Kind war ich von ihr fasziniert! Sie hat Grenzen überwunden, das ist auch ein bisschen mein Motto. Es darf hässlich, es darf provokant sein, wenn es darum geht, die verschiedensten Emotionen in der Musik darzustellen. Schönheit ist dabei nicht wichtig. Ich bewundere die Ehrlichkeit und die Beharrlichkeit dieser Drama-Queen.
Gehen Sie denn gerne in die Oper?
Fateyeva: Absolut! Vor Kurzem habe ich mir hier in Hamburg Schostakowitschs „Lady Macbeth von Mzensk“ angesehen. Der Austausch zwischen Theater, Oper und anderen Formen der Kunst ist sehr bereichernd, dabei komme ich auf neue Ideen. Zum Glück habe ich vor meiner Haustür so viele Möglichkeiten.
Kommen Sie bei Ihrem gefüllten Kalender noch zum Flamenco tanzen?
Fateyeva: Oh, ich habe erst heute daran gedacht! Leider reicht die Zeit nicht aus, da muss ich wieder eine Balance finden.