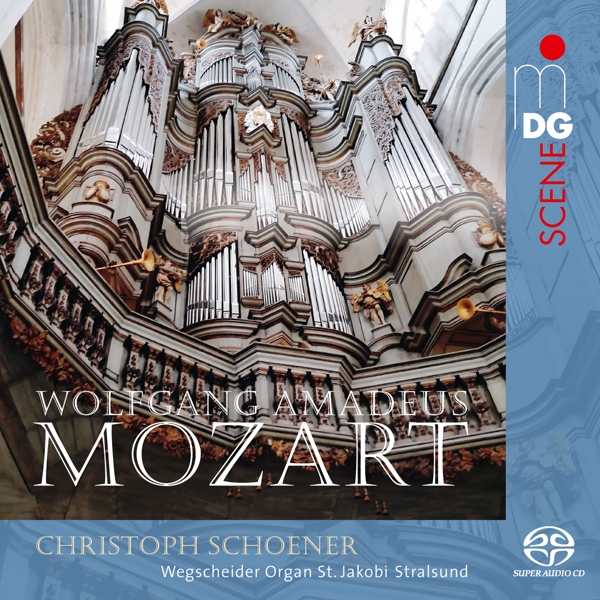Die Hauptkirche St. Michaelis ist nicht nur Hamburgs historisches Wahrzeichen. Der Michel ist mit den Traditionsaufführungen des „Weihnachtsoratoriums“, der „Matthäus-Passion“ oder des „Deutschen Requiems“ auch ein musikalisches Kraftzentrum der Hansestadt. Seit zwanzig Jahren ist Christoph Schoener Kirchenmusikdirektor von St. Michaelis und damit eine der prägenden Persönlichkeiten des Musiklebens.
Wie blicken Sie zurück auf zwanzig Jahre am Michel?
Christoph Schoener: Ich bin stolz auf meinen enorm fleißigen Chor, der von Monteverdi bis Rihm ein unglaubliches Repertoire gesungen hat. Eben nicht nur die Stücke, die hier als gesetzt gelten und ohne die es, so glaube ich, einfach nicht geht. Vor zwanzig Jahren habe ich mich gern eingefügt in diesen Kanon der traditionellen Stücke, denen ich allerdings noch mindestens zwanzig andere Werke hinzugefügt habe. Auch in der Frage der Aufführungspraxis Alter Musik war die Akzeptanz in Hamburg noch eher bescheiden, so denke ich an die Irritationen, als ich 1999 für meine erste Aufführung der „Johannes-Passion“ alte Instrumente eingesetzt habe. Im Kölner Raum, wo ich vorher gearbeitet hatte, war dies längst Standard ebenso wie für einige meiner Kollegen in Hamburg, aber für St. Michaelis war es eine echte Pioniertat. Dabei bin ich da völlig undogmatisch: Ich mache ja auch das „Weihnachtsoratorium“ und die „Matthäus-Passion“ mit modernen Instrumenten. Es ist eben keine Frage des Instrumentariums, sondern der Kenntnisse über Alte Musik und ihre rhetorischen Gesetze. Die Musik von Händel, Telemann und C. P. E. Bach kann ich mir allerdings nur mit Barockinstrumenten vorstellen.
Bleiben Wünsche offen?
Christoph Schoener: Ich hätte mir vorstellen können, das Brahms-Requiem einmal mit Psalmen von Zemlinsky zu ergänzen. Einmal habe ich Schönbergs „Moderner Psalm“ dem Brahms-Requiem vorangestellt, da wandte sich dann der Hauptpastor ans Publikum und sagte: „Fürchtet euch nicht!“ 1999 hatte ich mir Respekt bei einem Kritiker verschafft, indem ich das Mozart-Requiem mit Schönbergs „Ein Überlebender aus Warschau“ kombiniert habe. Danach schrieb mir ein Gemeindemitglied, ob ich mir im Klaren wäre, dass ich mit dieser Konzertdramaturgie die Opfer des Holocaust katholisch beerdigt hätte. Über die Reaktion habe ich mich natürlich geärgert. Heute muss ich gestehen: Der Herr hatte Recht. Ich würde das so nicht mehr verbinden.
Unbedingt möchte ich noch im Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag 2019 den „Actus Tragicus“ von Bach aufführen, das ist die Requiem-Musik, die mich am meisten erreicht. Wirklich etwas verpasst habe ich nicht. Allerdings habe ich erst spät Beethovens „Missa solemnis“ nachgeholt. Auf die Frage, wann ich das Stück machen würde, hatte ich zuvor immer geantwortet: „Wenn ich tot bin.“ Denn ich finde das Stück einfach irrsinnig schwer und hatte höchsten Respekt. Doch dann habe umgedacht: Man kann nicht zwanzig Jahre an einer der bedeutendsten Orte für Kirchenmusik sein und sich vor einem der wichtigsten geistlichen Werke drücken. Also musste ich die Missa machen und habe es keine Sekunde bereut.

Wie würden Sie diese Entwicklung des Chores beschreiben?
Christoph Schoener: Die Neugründung des Chores St. Michaelis 1998 fing nach einer kurzen A-cappella-Aktion so richtig an mit Bachs h-Moll-Messe. Nach zwei, drei Jahren konnte ich die Mitglieder auswählen, die ich aufnehmen wollte. Sie sind jeden Donnerstag wirklich gefordert, da bin ich dann auch stur: Bei mir steht die Intonation an erster Stelle, schon beim Töne-Lernen, verbunden mit der Frage: Wie klingt welcher Vokal und warum? Die Chorsängerinnen und Sänger sitzen in der Probe und denken wahrscheinlich: „Mein Gott, was hat er denn jetzt schon wieder?“ Aber ich spüre, dass sie mir vertrauen und willens sind, viel umzusetzen.
Überhaupt: Vertrauen ist das Schlüsselwort, ein Chorleiter ohne Sänger ist gar nichts. Umgekehrt braucht der Chor den freundlich-strengen Motivator. Es ist ein Geben und Nehmen. Schließlich geht es um das bestmögliche Ergebnis und darum, bei der Aufführung als Chorsänger Mitgestalter bei der Interpretation eines komplexen Kunstwerkes zu werden – ich glaube, das ist der Grund, warum die Leute hier so gern singen. Das ist dann schon toll, im Michel zu stehen. Woanders ist es auch toll, aber im Michel zu singen ist noch ein bisschen toller. Dazu haben wir exzellente Partner: Immer sehr gute Orchester und immer sehr gute Solisten, oft von internationalem Rang. Da kam zum Beispiel die große Emma Kirkby auf die Empore, stellte sich völlig allürenfrei hin und sang. Und freute sich, dass der Chor so gut ist.
Wie wichtig ist dieser Raum mit seiner besonderen Magie?
Christoph Schoener: Das Publikum kommt auch zu uns, weil es eben der Michel ist und diese Atmosphäre einmalig ist, egal, was für Musik erklingt. Aber doof sind die Menschen nicht. Zwei Jahre lang ein unterdurchschnittliches „Weihnachtsoratorium“ – und von den knapp 10.000 Leuten, die an jedem Wochenende des 4. Advent zu uns kommen, würden dann eben 3.000 wegbleiben und sich anderweitig orientieren. Dann wären wir pleite. Die Qualität wird schon dankend zur Kenntnis genommen, aber letztlich ist es der Raum, der die Menschen in den Bann zieht. Überhaupt darf man als Musiker die eigene Bedeutung nicht mit der Bedeutung der Kirche verwechseln. Säße ich jetzt irgendwo in der Provinz, würde das überregional niemand zur Kenntnis nehmen, insofern ist es ein hohes Privileg, Musiker am Michel zu sein, aber auch eine große Verantwortung.

Mit dem Michel ist just die Entstehung der „Auferstehungssinfonie“ Gustav Mahlers eng verbunden. Um dieses Werk haben Sie allerdings immer einen Bogen gemacht …
Christoph Schoener: Die Hamburger Gustav Mahler Vereinigung würde sich freuen, wenn ich im Michel die „Auferstehungssinfonie“ dirigieren würde. Aber soll ich dann danach etwa Kritiken lesen, in denen steht: „Also für einen Kirchenmusiker macht er das ja ganz schön“? Ich stelle mich doch nicht in Hamburg hin und dirigiere Mahler-Sinfonien, wo es Dirigenten gibt, die sich ein Leben lang mit Mahler-Sinfonien befassen. In solchen Dingen darf und muss ich skrupulös sein.
Ist Hamburg wirklich noch die viel beschworene Hauptstadt der Kirchenmusik?
Christoph Schoener: Hamburg ist schon historisch eine der bedeutendsten Orgelstädte. Diesen Status genießen wir bis heute. Und wenn man jetzt mal statistisch betrachtet, wie viele hauptamtliche Kirchenmusikerstellen es gemessen an der Bevölkerungszahl gibt, dann ist Hamburg sehr gut ausgestattet. International gesehen leben wir in Deutschland noch im kirchenmusikalischen Luxus, so eine Qualität von Laienchören – natürlich auch im weltlichen Bereich – gibt es in der ganzen Welt nicht noch einmal. Das liegt auch am hauptamtlichen Beruf des Kirchenmusikers, ein echtes deutsches Spezifikum mit dem Gesamtkunstwerk aus Orgelspielen und Dirigieren.
Doch diese Errungenschaft seit den sechziger Jahren geht durch die Sparpolitik der Kirchen zurück. Das heißt, wir werden irgendwann einen Zustand wie in den Zwanzigerjahren haben, und die große Kirchenmusik wird sich von der Kirche verabschieden. Oder die Kirche lässt sie ziehen. Noch fließen die Einnahmen durch die Kirchensteuer, die ich absolut gutheiße. Denn kulturell und auch sozial wäre es eine Katastrophe, wenn sie wegbräche. Da wäre nämlich die kostspielige Sakralmusik das erste, was geopfert werden würde. Nicht so an den Hauptkirchen Hamburgs und Deutschlands, und schon gar nicht am Michel. So gesehen lebe ich seit zwanzig Jahren im Paradies. Einfach Glück gehabt.