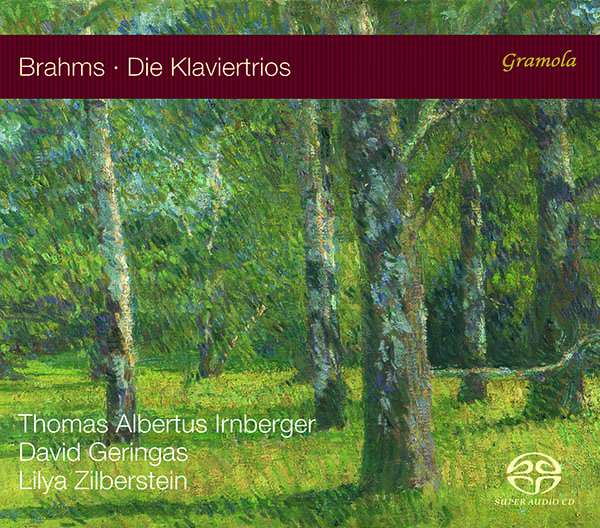Kurz vor unserem Interviewtermin meldet sich David Geringas von seinem Handy. Er sitze gerade in einem Café in der Nachbarschaft und da gäbe es diese heiße Schokolade, die man unbedingt probieren müsse. Nach diesem buchstäblich warmen Empfang lädt der Cellist in seine Berliner Wohnung. Unweit des Flügels steht sein erster ECHO. Seine Schülerin Sol Gabetta habe ja bereits fünf ECHOS, sagt Geringas – „da darf ich doch auch mal einen bekommen.“
Herr Geringas, Sie waren Schüler und enger Freund von Mstislaw Rostropowitsch. Können Sie sich noch an Ihre erste Begegnung erinnern?
Das war kurz nachdem ich die Aufnahmeprüfung am Moskauer Konservatorium bestanden hatte. Zwei Tage vor Beginn des Studiums wusste ich noch nicht, zu welchem Lehrer ich komme – und da traf ich Rostropowitsch auf dem Flur. Er empfahl mir als Lehrerin eine ehemalige Schülerin von ihm. Als ich ihr dann vorspielte, ist sie fast vom Stuhl gefallen. Sie hat Rostropowitsch sofort von mir erzählt und durch einen Zufall kam ich dann in seine Klasse: Ein Schüler hatte wegen einer Handverletzung absagen müssen, da konnte ich nachrücken. Rostropowitsch teilte es mir auf der Treppe mit, er sagte: „Mit dir ist ein Unglück passiert – ich muss dich in meine Klasse aufnehmen.“
Wie würden Sie die Atmosphäre damals am Konservatorium beschreiben?
Es war eine fantastische Klasse mit großen Cellisten und Rostropowitsch hat mit seiner Art zu unterrichten eine sehr inspirierende Atmosphäre geschaffen. Und wenn er jemanden kritisiert hat, dann war das gleichzeitig motivierend. Oft brachte er neue Stücke mit, die er gerade einstudierte, das zweite Cellokonzert von Schostakowitsch etwa wurde schon in unserer Klasse gespielt, noch bevor es überhaupt fertig war. Er war wie ein Komet, der mit Lichtgeschwindigkeit flog – und wir Schüler waren der Schweif. Er hat uns mit sich gezogen.
Was haben Sie vom Lehrer Rostropowitsch übernommen, als Sie später selbst eine Celloklasse hatten?
Bei Rostropowitsch waren wir alle eng miteinander verbunden – und das passierte auch in meiner Klasse in Lübeck, das war wie eine kleine verschworene Gesellschaft. Wir haben zusammen gekocht, einander vorgespielt, zusammen Fußball gespielt … So etwas ist wichtig, weil sich sonst sehr schnell Konkurrenz, Neid und Eifersüchteleien entwickeln.
Wo sehen Sie den Ursprung für eine musikalische Begabung? Ist das genetische Veranlagung?
Ich denke, dass wir alle talentiert geboren werden. Nur entwickeln sich die Kinder unterschiedlich, abhängig von der Umgebung, in der sie aufwachsen. Man kann aber jeden Menschen motivieren, etwas zu erreichen. Zum Beispiel hatte ich einen Schüler, der sehr spät, mit 18, angefangen hat, Cello zu spielen. Trotzdem konnte er bereits nach sieben Jahren die Sinfonia Concertante von Prokofjew spielen.
Wenn Sie sich heute die Karrieren Ihrer Schüler Sol Gabetta oder Johannes Moser anschauen: Sieht man als Lehrer in diesen Erfolgen auch ein Stück weit die eigene Leistung?
Da möchte ich gerne den großen Dirigenten Hans Schmidt-Isserstedt zitieren. Er sagte: „Um acht Uhr abends endet jeder Protegé.“ Das heißt, sobald das Konzert beginnt, bleibt jeder Künstler alleine auf der Bühne. Dann ist es seine Leistung und seine Verantwortung. Ich freue mich wahnsinnig, wenn Schüler von mir Erfolg haben. Aber das ist nicht nur mir zuzuschreiben.
Haben Sie Ihre Schüler auch beraten, wenn es um Plattenfirmen und Verträge ging?
Als Lehrer kriegt man sehr viele Fragen – und man muss auf alle eine Antwort finden. Mir ging es als Lehrer darum, mit den Schülern eine Basis zu schaffen, auf der sie ihr Leben aufbauen können. Ich wollte, dass sie nicht nur ein Brot zu essen haben, sondern auch eine ganz dicke Wurst drauf. Viele haben das auch geschafft, einige sind inzwischen selbst Professoren und die anderen haben im Konzertleben eine wichtige Aufgabe gefunden.
Sie haben mehrere Werke mit dem elektrischen Cello aufgeführt. Mögen Sie das E-Cello?
Ich finde, es ist ein anderes Instrument, man muss es nicht als die Weiterentwicklung des Cellos sehen. Es bietet neue Möglichkeiten, die man aber mit der Cello-Technik, die man beherrscht, nutzen kann. Nur die Dynamik ist nicht so beherrschbar wie beim normalen Cello. Beim E-Cello wird die Lautstärke ja an einem Regler eingestellt. Als ich das Konzert von Erkki-Sven Tüür gespielt habe, saß der Komponist im Saal und hat den Celloklang mit verschiedenen Effekten manipuliert. Das heißt: Was dann auf dem Instrument passiert, ist eine ganz neue Welt.
Weckt es bei Ihnen auch Assoziationen zur Rock-Musik?
Ich habe das Konzert von Tüür viele Male mit einem Fußpedal gespielt. Und da fühlte ich mich tatsächlich wie ein richtiger Rockmusiker. Mein bestes Erlebnis mit dem E-Cello hatte ich 2002, als wir mit dem Orchester von Michail Pletnjew im großen Saal des Tschaikowsky-Konservatoriums probten. Ich hatte mein E-Cello mitgebracht und vor mir stand ein großer Lautsprecher. Der sah ziemlich alt aus, also habe ich vorsichtshalber den Lautstärkeregler am Cello ein kleines bisschen hochgezogen. Als ich dann anfing zu spielen, kam sofort der Orchesterdirektor herbeigelaufen und sagte: „Es ist eine Katastrophe, wir können das Orchester nicht hören.“ Da habe ich den Regler schnell wieder zurückgedreht. (lacht)
Warum war das Ihr bestes Erlebnis?
Weil in dem Moment meine Cellisten-Seele jubiliert hat. Ich fühlte mich als Rächer aller Cellisten auf dieser Welt, für all die Dvořák-Konzerte, in denen man das Cello nicht hört, weil das Orchester zu laut ist. Ich hatte es endlich geschafft, das Orchester unhörbar zu machen.
Das klingt fast nach einem Trauma. Sind die Orchester häufig zu laut?
Je besser ein Orchester ist, desto besser kann es leise spielen. Wenn ich mit Valery Gergiev und seinem Orchester das Dvořák-Konzert spiele, kann man das Cello mit jeder Note und in jeder Nuance hören. Doch das ist nicht überall so. Zum Beispiel, wenn Orchestermusiker aufgeregt sind, dann spielen sie automatisch lauter – da kann man nichts machen. Leise zu spielen erfordert eine sehr gute Technik.
Immer wieder treten Sie auch mit Ihrem Beethoven-Zyklus auf. Welche Idee steckt dahinter?
Ich habe den Beethoven-Zyklus schon zwei Mal mit Ian Fountain aufgenommen. Und das Schöne dabei war, zu spüren, dass man Beethovens Leben gelebt hat, von den ganz jungen bis zu den älteren Jahren. Unsere Sonaten gehen von Opus 5 bis 102 – das ist wirklich ein gelebtes Leben!