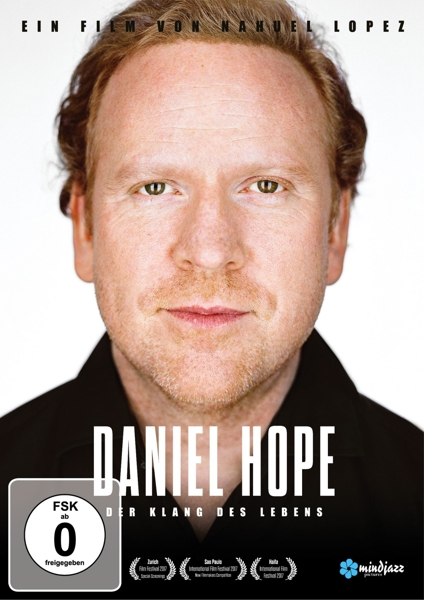Einen „global boy next door“ nannte ihn der „New Yorker“ einmal – eine Bezeichnung, die Daniel Hope schmunzeln lässt. „Boy – das ist wirklich eine Weile her“, antwortet der Geiger in seinem typischen Humor. Er selbst sehe sich lediglich als leidenschaftlichen Musiker. Oder, wie er es einmal ausgedrückt hat, als „Musikaktivist“.
Herr Hope, man kennt den Begriff „Aktivist“ aus der Politik, aber was verstehen Sie darunter?
Daniel Hope: Im Gegensatz zu Politikern sind wir Musiker mit der Wirkung dessen, was wir tun, jeden Tag konfrontiert. Das habe ich bemerkt, als ich als Stipendiat von Live Music Now in London war, jenem wunderbaren Verein von Yehudi Menuhin, der Musik in Pflegeheime, Krankenhäuser, Gefängnisse bringt und der besonders in Deutschland aktiv ist. Und als ich mit den Kindern sprach, habe ich gemerkt, was für eine einmalige Wirkung Musik auf jeden einzelnen haben kann: eine sehr unmittelbare!
Die Menschen danken es Ihnen auch.
Hope: Ich bekomme bei jedem Konzert Geschenke! Das können Sie sich nicht vorstellen …
Ich nehme an: Blumen, eine Flasche Wein …
Hope: Nicht nur. Auch werden fast regelmäßig Gedichte für mich verfasst. Ich bekomme Bilder und viele Briefe. Neulich habe ich in Essen gespielt. Da kam eine ältere Dame auf mich zu und übergab mir einen silbernen Trinkbecher des Geigers Joseph Joachim. Von ihm selber beschriftet mit einem Musikzitat und seiner Unterschrift. Der Vater der Dame war Cellist und sehr eng mit dem Umfeld von Johannes Brahms verbunden. Die Dame hatte von meiner Liebe und meinem Interesse für Joachim gelesen und dachte, der Becher sei bei mir in guten Händen. Ich war sehr bewegt.
Sie gehen immer wieder neue Projekte an. Das jüngste ist …
Hope: … eine Reise zu Mozart. Mozart ist für uns Musiker die höchste Instanz. Der Respekt, die Ehrfurcht vor seinem Werk hält ein ganzes Leben an und wächst stetig weiter. Mozart war immer bei mir, ich habe immer viel von ihm gespielt. Irgendwann aber kam der Moment, wo ich mir dachte: Jetzt nimmst Du einige seiner Werke auf. Im zweiten Jahr als Musikdirektor des Zürcher Kammerorchesters sind wir sehr zusammengewachsen, wir haben einen fabelhaften musikalischen Austausch, und ich spürte, dass nun der Moment gekommen war, mit diesem wunderbaren Orchester Mozarts drittes Violinkonzert einzuspielen. Das Orchester ist mir seit meiner Kindheit so nah wie meine Familie. Den Klang des dritten Violinkonzertes von Mozart, besonders des zweiten Satzes, habe ich immer noch im Ohr, wie damals, als ich ihn als Kind zum ersten Mal hörte, gespielt von Yehudi Menuhin und dem Zürcher Kammerorchester. Er ist sozusagen tief in meiner DNA verankert.

Fast vierzig Jahre später haben Sie nun als Musikdirektor des Orchesters dies zum Ausdruck bringen können.
Hope: Ein reines Mozart Album hätte ich persönlich weniger interessant gefunden, es sei denn, man nimmt sein ganzes Violinrepertoire auf – und dies hätte natürlich nicht auf eine CD gepasst. Ich habe über die Jahre viel recherchiert. Es gibt im Umfeld von Mozart viele spannende Komponisten, die da mals teilweise berühmter waren als er und dennoch heute absolut vergessen sind. Und dann dachte ich an eine Art Reise zu Mozart, es ging mir nicht nur um den historischen Kontext, sondern auch um einen emotionalen.
Wie meinen Sie das?
Hope: Ich habe darauf geachtet, dass die Werke im Ausdruck, in der Stimmung, in der Tonart zueinander passen. Ich wollte eine Brücke zwischen den verschiedenen, sehr individuellen Komponisten bauen. Zwischen Gluck, Haydn, Mozart, Mysliveček und Salomon.
„Haydn führt uns aus uns heraus“, schreibt der Bibliograf Constantin von Wurzbach 1869, „Mozart versenkt uns tiefer in uns selbst und hebt uns über uns.“
Hope: Teilweise stimmt das so. Auf der anderen Seite: Als ein Mann Haydns Musik kritisierte, soll Mozart gesagt haben: „Herr, merken Sie sich, wenn man uns beide zusammen schmilzt, wird noch lange kein Haydn daraus!“ Man darf allerdings nicht immer jeden Satz, jede Provokation ernst nehmen. Gerade Mozart wollte so auch auf sich aufmerksam machen. Aber in seiner intimsten Musik offenbart sich eine einzigartige Verletzlichkeit, die es so bei Haydn nicht gibt. Und wenn ja, dann äußert sie sich ganz anders. Mozart zeigt sich sozusagen nackt, Haydn bleibt immer irgendwie angezogen, wenn man das so platt formulieren möchte.
Wer war übrigens Josef Mysliveček?
Hope: Ein hochinteressanter Komponist, der aus Böhmen kam und in Italien sehr gefeiert wurde. Er war eng mit Mozart befreundet und hatte ein schweres Schicksal. Er ist früh an Syphilis erkrankt und musste schwere Operationen durchstehen, die sein Gesicht entstellten. Mozart hielt zu ihm und besuchte ihn im Krankenhaus. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die beiden seelenverwandt waren. Wenn bei Mysliveček die Geige einsetzt, dann höre ich Mozart.
Erzählen Sie uns etwas über Johann Peter Salomon.
Hope: Eine ebenfalls schillernde Figur. Er war ein bekannter Konzertveranstalter, aber auch ein Dirigent und Musiker. Er war mit der Familie Beethoven befreundet, er kannte ebenfalls Haydn. Und er hat eine hinreißend schöne Romanze für Violine und Orchester hinterlassen, 1810 komponiert, die für mich die Ära der Romantik einleitet, besonders im Hinblick auf den Geigenpart.
Apropos Salomon als Konzertveranstalter. Wie muss man sich die damaligen Konzerte vorstellen?

Hope: Es gab Konzerte in klirrender Kälte, vier, oft auch fünf Stunden lang. Viele Stücke wurden prima vista gespielt; ein sehr gemischtes Repertoire, zum Beispiel ein Satz von Mozart, einer von Beethoven und da nach die Improvisation über eine Melodie aus der neuesten Oper. Ganze Sinfonien ununterbrochen zu spielen, war sehr unüblich. Man konnte während des Konzerts rein und rausgehen. In den Opernhäusern vergnügten sich die Herren mit ihren Kurtisanen in den Pausen. Und wenn die Musik gefiel, dann hat man hemmungslos geklatscht, nicht nur nach dem Satz, sondern gerne auch mal mittendrin. Der Satz musste dann auch wiederholt werden. Konzerte waren Events, zwischen Himmel und dem absoluten Grauen.
Heute kritisieren wir dies als musikalisches Fastfood, als Crossover.
Hope: Ich glaube, wenn wir heute Künstler wie Vivaldi oder Mozart hätten, würden sie sich an keine Normen und keine Konventionen halten. Sie hätten kein Problem mit einem gemischten Programm.
Vater Leopold Mozart schreibt an seinen Sohn, bei seiner Arbeit auch das „ohnmusikalische Publikum“ zu bedenken: „Vergiß also das so genannte populare nicht, das die langen Ohren Kitzelt.“
Hope: Genau! Man muss dazu auch sehen, dass den Komponisten am wichtigsten war, dass sich ihr Werk durchsetzt, dass es von so vielen wie möglich gehört wurde. Das vergessen wir immer. Wir sind es, die altmodisch wirken. Damalige Komponisten waren früher in manchen Dingen sehr viel freier als wir. Und hinzufügen muss man, dass diese Komponisten damals noch in der Lage waren, eine Revolution ausrufen zu können – ich denke da an Gluck mit seiner Opernreform. Das können wir heute nicht mehr. Das meiste ist wohl schon musikalisch gesagt, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen.
Sämtliche „neue“ Konzertprogrammformate wenden sich vornehmlich an die Jugend. Dabei haben Studien ergeben, dass immer mehr Menschen, die älter sind als 65, ins Konzert gehen. Sollte man sich nicht mehr um die kümmern?
Hope: Es ist ein komplexes Thema. Es bleibt eine Katastrophe, dass in den Schulen zu wenig getan wird. Wo ich eher ein großes Manko sehe, ist bei der Generation in meinem Alter – nicht ganz jung, aber auch noch nicht alt. Wo ist die? Als Kind hat man meist ein Instrument gespielt, aber über die Jahre ist die Liebe und Hinwendung zur Musik abhanden gekommen. Und das finde ich verheerend.