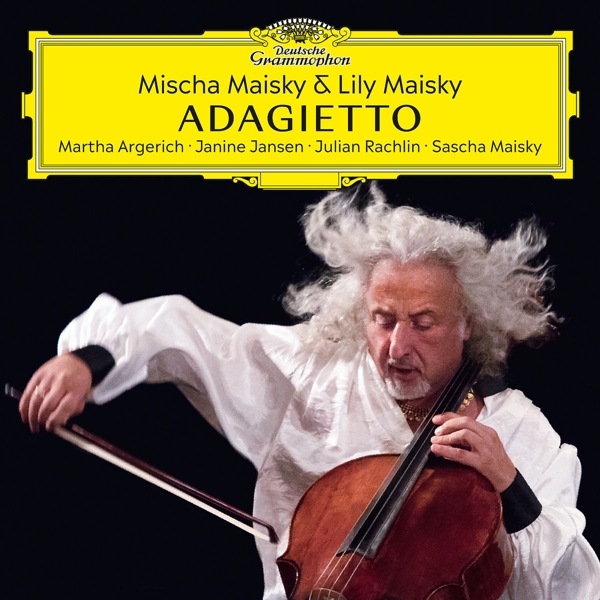Mischa Maisky ist nicht nur einer der führenden Cellisten der Welt, er ist auch ein angenehmer, schnell und lebhaft sprechender Interviewpartner, der in seinen meist langen Antworten immer wieder in die verschiedensten Gebiete abschweift und lustige Anekdoten einflicht. Dass aus der verabredeten halben Stunde schließlich eine ganze wurde und er sofort zum nächsten Termin eilen musste, störte ihn anscheinend überhaupt nicht.
Herr Maisky, Sie sammeln Aufnahmen der Bach-Suiten. Wie viele haben Sie inzwischen?
Weit über 50, ich habe aufgehört zu zählen. Ich bin neugierig, ich kaufe immer neue. Weil es immer etwas zu lernen und zu entdecken gibt.
Welche Qualität muss eine Aufnahme haben, damit Sie sie häufiger hören?
Sie muss etwas haben, das einen über die Musik nachdenken lässt, das eine neue Perspektive eröffnet. Großartige Musik – und es gibt keine größere als Bach – ist wie ein Diamant, der viele verschiedene Facetten hat. Ich habe Kompilationen gemacht: 35 Préludes hintereinander, 35 Mal die erste Allemande hintereinander. Und manchmal glaubt man nicht, dass es sich um dasselbe Stück handelt. Das ist verrückt – aber auch wunderbar. Generell ist es eine Frage der Einstellung: Man sollte so offen und tolerant wie möglich sein im Leben. Das Problem des Menschseins, wenn ich versuchen darf zu philosophieren, ist, dass Menschen Angst haben vor Unterschieden. Die meisten Kriege sind wegen unterschiedlicher Götter oder Religionen oder Ideologien entstanden. Dabei können wir doch alle profitieren von Unterschieden und verschiedenen Arten zu leben, zu denken, zu essen oder Bach zu spielen. Das ist wunderbar. Ich sage immer: Ich bin sehr kosmopolitisch. Ich bin in Lettland geboren, in Russland aufgewachsen und nach Israel repatriiert – nicht emigriert, das ist ein psychologisch wichtiger Unterschied. Ich wohne in Belgien, spiele ein italienisches Cello mit französischen und deutschen Bögen, ich benutze deutsche und österreichische Saiten, ich fahre ein japanisches Auto, habe eine schweizer Uhr und trage eine indische Halskette. Meine erste Frau war Amerikanerin – niemand ist unfehlbar –, meine zweite Frau ist Italienerin, aber ihr Vater stammt aus Sri Lanka. Ich habe vier Kinder, die in Paris, in Brüssel, in Italien und in der Schweiz geboren sind – vielleicht reise ich zu viel. Wenn ich gefragt werde, wo ich zu Hause bin, antworte ich: Überall da, wo die Menschen klassische Musik mögen. Heute bin ich in Berlin zu Hause, morgen in Madrid, gestern war es Paris. Auch wenn es ein schwieriges Leben ist, ist es doch faszinierend. Man sieht verschiedene Orte, man kann zumindest die Atmosphäre schmecken, lernt verschiedene Leute kennen, das finde ich enorm stimulierend. So ist es auch mit der Musik. Es gibt Tausende Wege Bach zu spielen. Nur zwei darf man nicht gehen: Man darf großartige Musik nicht hässlich spielen und nicht langweilig.
Ihr Bach-Spiel wirkt, als seien die Errungenschaften der historischen, „authentischen“ Aufführungspraxis spurlos an Ihnen vorbeigegangen.
Ich glaube sehr an Authentizität – an die Authentizität der Gefühle. Was immer vom Herzen des Künstlers kommt, ist authentisch.
Egal, wie man die Suiten zu Bachs Zeiten gespielt hat?
Es gibt keine Schallplatten aus dem 18. Jahrhundert. Natürlich können wir vieles erschließen, aber die Grenze verläuft für mich da, wo Leute sagen: Wir wissen nicht nur, wie man das Stück zu Bachs Zeiten gespielt hat – wir wissen auch, wie Bach es hören wollte. Als würden sie sich täglich mit ihm unterhalten. Wenn man Bach wiederbeleben und in die Philharmonie setzen und ihm anbieten würde, die Matthäuspassion mit einem kleinen Orchester des 18. Jahrhunderts oder mit den Berliner Philharmonikern zu hören – ich bin mir nicht sicher, was er wählen würde. Wir werden es nie wissen. Bach war unglaublich progressiv, wie alle großen Geister. Ich mag falsch liegen, aber ich denke, er würde sich im Grab herumdrehen, wenn er hören würde, dass Musiker von heute die Zeit um 300 Jahre zurückdrehen wollen.
Hat Bach überhaupt noch das Copyright an seinem Werk?
Der Komponist ist immer wichtiger als der Interpret. Aber großartige Musik ist universell, für Bachs Musik gibt es keine Grenzen. Wenn mich Leute fragen, ob ich moderne Musik spiele, antworte ich: Natürlich, ich spiele Bach. Bach einen Barockkomponisten zu nennen, ist eine Beleidigung! Es gibt Barockkomponisten, aber das ist etwas ganz anderes. Bach war so viel größer. Ich glaube, viele Leute fühlen sich nicht wohl in der Nähe eines solchen Genies. Sie versuchen ihn kleiner zu machen, in einen Rahmen zu packen und ein Etikett drauf zu kleben: Dies ist ein Barockkomponist – oder ein intellektueller Komponist. Bach passt in keinen Rahmen. Bach hatte 20 Kinder, er war nicht bloß ein Intellektueller, er hat nicht nur 18 Stunden am Tag Fugen geschrieben.
Wie nähern Sie sich diesen Werken? Ganz subjektiv?
Kunst ist subjektiv. Sonst würde ein Computer die beste Interpretation liefern. Natürlich müssen die Emotionen ausbalanciert werden mit der Form, die Architektur eines Stückes ist enorm wichtig. Aber ich spiele nicht für Connaisseure – die brauchen mich nicht, die können in die Noten gucken. Ich spiele für Leute, die diese Musik zum ersten Mal hören. Und die müssen nicht wissen, wie ausgeklügelt eine Bach-Fuge konstruiert ist. Das ist ja das Erstaunliche an dieser Musik, dass sie konstruiert ist und doch die Herzen der Menschen unmittelbar berührt. Wenn mir Leute vorwerfen, dass ich Bach romantisch spiele, nehme ich das als Kompliment. Bach war für mich der größte Romantiker seiner Zeit. Auch die Menschen des 18. Jahrhunderts hatten Gefühle, vielleicht mehr als heute.
Wenn man Ihre alten Aufnahmen mit neuen vergleicht, wirkt es, als fühlten Sie sich heute viel freier.
Das ist auch so. Wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich meine grauen Haare. Aber ich fühle mich jünger. Vielleicht weil ich eine junge Frau und kleine Kinder habe – warten Sie, ich zeige Ihnen Fotos, ich bin ein stolzer Vater… Meine Karriere, oder wie man es nennen will, hat früh begonnen. Ich habe bei Rostropowitsch studiert, aber dann ging meine Schwester nach Israel, und ich kam ins Gefängnis. Ich habe 18 Monate im Arbeitslager Zement geschippt, zwei Monate war ich in einer psychiatrischen Klinik, weil ich nicht Soldat werden wollte. Ich habe fast zwei Jahre mein Cello nicht gesehen. Als ich in den Westen kam, war ich fast 25 und musste von Null anfangen – und war plötzlich mit neun- oder zehnjährigen Wunderkindern konfrontiert. Ich habe mich unglaublich alt gefühlt. Dann habe ich bei Piati-gorsky studiert, was wahrscheinlich die beste Zeit meines Lebens war – nicht weil er ein besserer Lehrer als Rostropowitsch gewesen wäre, ich war ein besserer Schüler. Ich war voller neuer Energie, es war für mich ein Neuanfang, und er wollte noch etwas weitergeben. Und eines Tage sagte er zu mir: Weißt Du, Mischa, ich stehe am Ende meines Lebens, ich habe keine Zeit mehr, in Eile zu sein. Ich habe lange gebraucht, das zu verstehen. Ich war damals sehr in Eile. Aber heute habe ich das Gefühl, das ganze Leben liegt vor mir. Ich habe Zeit.
War die Musik ein Lebensretter im Arbeitslager?
Die Musik war etwas, was sie mir nicht nehmen konnten. Ich bin in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen, obwohl meine Eltern wegen der Umstände nicht Musiker werden konnten. Meine ältere Schwester ist Pianistin, mein älterer Bruder war Musikwissenschaftler und Organist. Seit ich im Bauch meiner Mutter hören konnte, war ich von Musik umgeben. Musik war wie Luft für mich. Meine Mutter hatte zwar entschieden, wenigstens ein Kind sollte „etwas Normales“ werden und kein Musiker. Aber ich war alles andere als normal. Ich war acht, als ich angekündigt habe, ich werde Cellist. Alle hielten mich für verrückt. Ich war ein hyperaktives Kind, keiner konnte sich vorstellen, dass ich mehr als fünf Minuten ruhig sitzen könnte.
Warum Cello?
Meine Schwester spielte Klavier, mein Bruder begann damals mit der Geige, da war das Cello die natürliche Ergänzung. Es hätte auch ein anderes Instrument sein können. Ein Instrument ist nur ein Instrument. Das wichtigste ist, Musik zu machen. Es gibt ein wunderbares Plattencover von Rostropowitsch bei der EMI, da hält er den Bogen in der linken und das Cello in der rechten Hand. Das hat jemand seitenverkehrt gedreht, und niemand hat es gemerkt, als es in Druck ging. So geht es mir manchmal im Konzert und in den Wettbewerben. Die jungen Musiker spielen immer besser, sauberer, schneller – aber die Musik gerät ins Hintertreffen. Es geht nicht darum, zu zeigen, wie gut man spielen kann. Da läuft etwas grundverkehrt. Ich werde nie der beste Cellist werden, aber ich könnte durchaus präziser und klarer spielen, wenn ich mich darauf konzentrieren würde. Aber ich weiß, dass dann etwas anderes, das für mich wichtiger ist, verloren ginge: die Expressivität. Die ist mir wichtiger als Perfektion.
Sie spielen oft die Bach-Suiten. Sind das die Werke, die Ihnen am nächsten stehen?
Sie sind die größte Herausforderung. Und die schönste, wenn sie glücken. Wenn ich Musik in gewisser Weise meine Religion nennen kann, dann ist Bach für mich die Bibel, das Buch der Bücher. Ich bin kein Spezialist für die Bibel, aber ich weiß, man kann sie ganz verschieden auslegen. So ist es auch mit den Bach-Suiten. So lange wir leben, werden wir nicht zu der perfekten Interpretation kommen – weil Musik lebt. Bach ist für mich so modern wie vor 300 Jahren.
Welches Stück wünschen Sie sich zu Ihrem Begräbnis?
Das ist, als sollte ich sagen, welches meiner vier Kinder ich am meisten liebe. Das kann ich nicht beantworten, das könnte auch Schubert oder Richard Strauss oder Mahler sein. Ich halte es mit Woody Allen, der gesagt hat: Ich habe keine Angst vor dem Sterben. Aber ich muss nicht selbst dabei sein.