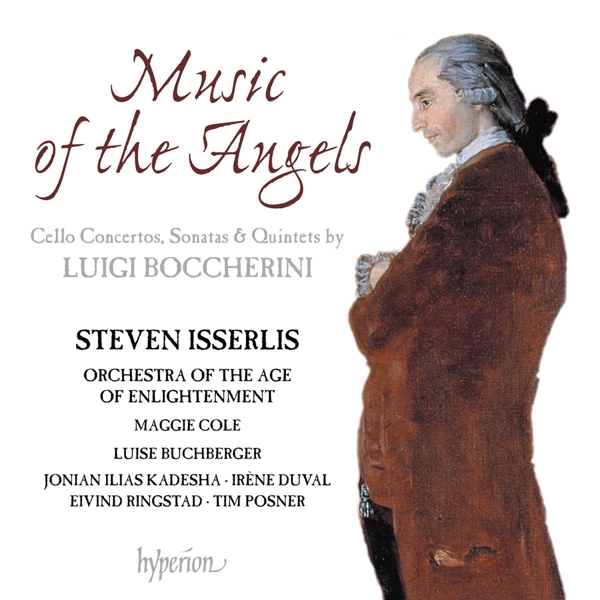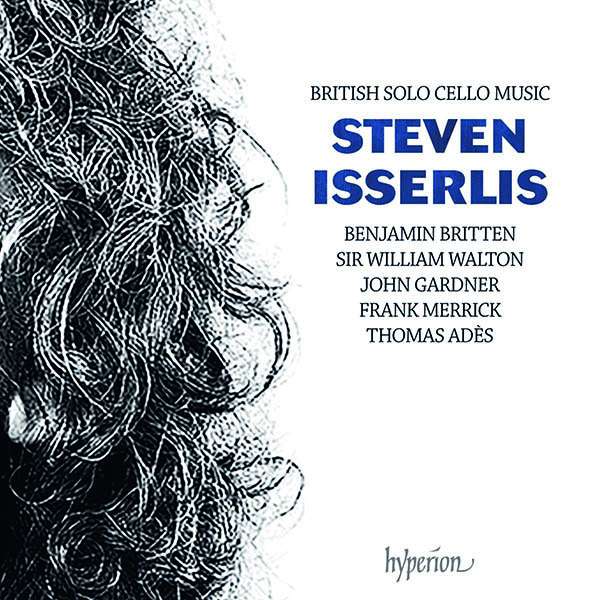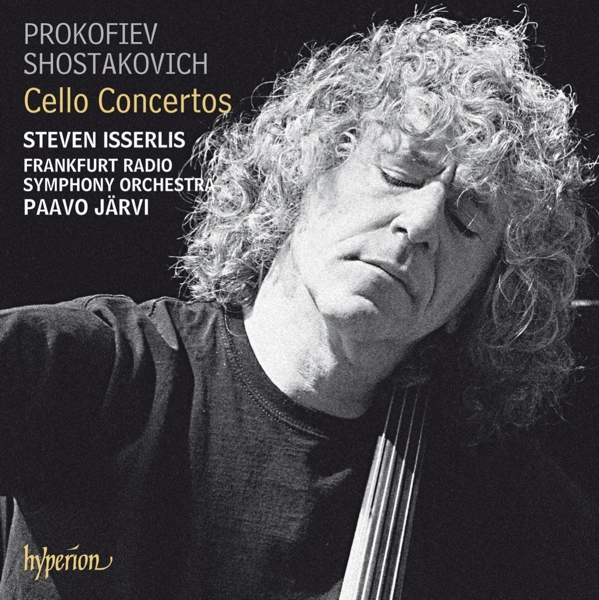Sehr, sehr britisch. Mit entsprechendem Humor. Wer mit Steven Isserlis spricht, hat zunächst einen gebildeten, unaufgeregten und äußerst smarten Menschen vor sich. Doch dann erzählt der Lockenkopf, der neben Yo-Yo Ma, Sol Gabetta und anderen Könnern des Fachs offensichtlich immer das zweite Cello spielen muss, von seiner Jugendzeit und überrascht mit Anekdoten. Genauso wie auch in seinen Kinderbüchern.
Im letzten Jahr durften Sie bei Ihrem Beethoven-Rezital mit András Schiff in Bonn ein Original-Cello von Beethoven spielen. Wie klingt es?
Steven Isserlis: Wir lieben uns! Also, das Cello und ich. Es gibt zwei erhaltene Celli von Beethoven, aber dieses ist offensichtlich im besseren Zustand. Ein wunderbares Instrument! Seit über 50 Jahren wurde damit kein Konzert mehr gegeben. Ich dachte, sein Klang wäre nach 50 Jahren ziemlich schläfrig, aber so war es nicht: Es war hellwach.
Eine andere große Liebe von Ihnen gilt Dvořáks Cellokonzert.
Isserlis: Ich habe es erstmals gespielt, als ich 14 Jahre alt war; ich bin damit aufgewachsen und es wuchs mit mir, je älter ich wurde: Es hat sich in dieser Zeit stark verändert. Ich weiß gar nicht warum … (schmunzelt) es wurde immer – erwachsener! Dvořáks Cellokonzert hat alles, was ein großes Werk braucht: Tiefe, Tragik, Feierlichkeit – eine Musik des Abschieds, er hat es in seiner Zeit in Amerika geschrieben. Mit dem Mahler Chamber Orchestra unter Daniel Harding habe ich das Werk bereits einmal aufgenommen.
Planen Sie, es nochmals aufzunehmen?
Isserlis: Bestimmt. Aber das wird noch einige Jahre dauern. Wie gesagt: Es wächst mit der Zeit. Es ist ja immer anders, ein Werk zu erleben, mit einem anderen Orchester, in einem anderen Konzertsaal, zu einer anderen Zeit: Du machst es einfach anders, du fühlst es, und das ist für alle Beteiligten höchst spannend. Es bedeutet immer, einen Dialog mit offenem Ausgang zu führen.
In einem anderen Cellokonzert, nämlich in dem Elgars, haben Sie persönlich Einsamkeit und Selbstzweifel entdeckt – haben Sie jemals Selbstzweifel in Ihrer Karriere empfunden?
Isserlis: Das Cellokonzert ist voller Fragen, unbeantworteter Fragen. Es ist jene Tiefe, die das Stück so relevant und bewegend macht. Aber was die Selbstzweifel betrifft: Die habe ich jeden Tag, definitiv.
Sie stehen jeden Tag damit auf? Sechs Uhr morgens: Der Tag beginnt mit Selbstzweifeln …
Isserlis: … na ja, so früh fängt das nicht an. Aber jeder Künstler, der hart an sich arbeitet, kennt das Gefühl: Er ist niemals zufrieden. Man wächst mit dem Repertoire, man hinterfragt den jeweiligen Ansatz und möchte mit jedem Mal besser werden. In allen wirklich großen Werken ist das vom Komponisten so angelegt: Widersprüche, Brüche, Fragen. Zweifeln ist also eine gute Sache – verzweifeln natürlich nicht.
Nun spielen Sie nicht nur Musik, sondern schreiben auch darüber.
Isserlis: Ja, gerade habe ich die Textfahnen meines nächsten Buches vom Verlag zur Korrektur erhalten – es erscheint im September. Der englische Titel lautet „Advice for Young Musicians“: Es basiert auf Schumanns Anleitung für junge Musiker. Ich habe es für junge Leute und Musikliebhaber geschrieben, die gerne wissen möchten, was hinter der Musik liegt.
Klingt spannend, nur: Wie finden Sie bei Ihren vielen Verpflichtungen auch noch die Zeit, Bücher zu schreiben?
Isserlis: Auf den langen Konzertreisen, im Flugzeug, im Hotel – da mache ich auch meine Facebook-Einträge, auf die die Leser direkt reagieren und konkret nach Ratschlägen fragen. So haben sich mit der Zeit einige gute Gedanken angesammelt, worauf ich mir Schumanns Text genauer vornahm: Ich habe versucht, ihn für die heutige Zeit wieder relevant zu machen und gleichzeitig zu überprüfen, welche Antworten er der heutigen Generation liefern kann. In meinen ersten beiden Büchern habe ich eher lustige Geschichten erzählt.
Zum Beispiel, warum Beethoven mit Gulasch um sich warf …
Isserlis: … ja, so lautete der Titel des ersten Buches, das 2005 erschien. Ich wollte Geschichten erzählen, die für Kinder leicht zugänglich sind, gleichzeitig aber auch historisch korrekt bleiben. Als es um Tschaikowsky ging, wollte ich ganz bewusst nicht verschweigen, dass er im damaligen gesellschaftlichen Kontext mit seiner Homosexualität zu kämpfen hatte und dass er an der Cholera starb. In der japanischen Ausgabe des Buches wurde übrigens das gesamte Kapitel gestrichen – angeblich aus Platzgründen: Da habe ich mich schon etwas gewundert. Aber es gibt daneben so viele skurrile und ungewöhnliche Dinge, über die man schreiben kann und die das Kopfkino anregen. Das funktioniert bei Kindern ja fast automatisch – etwa warum Händel mit der Perücke wackelte: Er groovte mit und wollte das langweilige Publikum animieren. Zu seiner Zeit war er ja ein Popstar und sehr bekannt.
Hat Ihr Sohn Sie inspiriert, als Sie die Bücher konzipierten?
Isserlis: Ja, eigentlich habe ich die Sachen zunächst für ihn geschrieben. Gabriel fragte mir ständig Löcher in den Bauch: Er hat mich immer wieder überrascht – ungefiltert und direkt. Kinder sagen manchmal Dinge, die sich so oder ähnlich bei den großen Philosophen und Denkern wiederfinden.
Das scheint ja in der Familie zu liegen: In Ihrem Stammbaum finden sich einige bekannte Namen, darunter Karl Marx und Helena Rubinstein.
Isserlis: In der Tat ist meine Familie recht verzweigt: Unsere Wurzeln liegen in Russland und der jüdischen Kultur. Mein Großvater Julius Isserlis, selbst ein bekannter Musiker, hat das kommunistische Russland 1923 verlassen und eine wahre Odyssee hinter sich gebracht: Riga, Berlin, Prag – das muss hart gewesen sein. Schließlich landete er in Wien – und nachdem die Nationalsozialisten immer größeren Einfluss gewannen, nutzte er dann eine Konzertreise durch England, um in London zu bleiben.
Sie selbst sind in London aufgewachsen und dort zur Schule gegangen. Waren Sie ein guter Schüler?
Isserlis: Nun, sagen wir es mal so: Es ging einiges zu Bruch in der City of London School. Ein schwarzes Brett musste dran glauben, und die Motorhaube eines Lehrers …
… wie ist das denn passiert?
Isserlis: Ich habe eine Aktentasche aus dem Fenster geworfen und sie landete erstaunlicherweise auf der Motorhaube seines neuen Autos – eine ansehnliche Delle war das Ergebnis. Ich war wohl ein recht aktiver Schüler damals, der Klassenclown – oder besser: der musikalische Klassenclown.