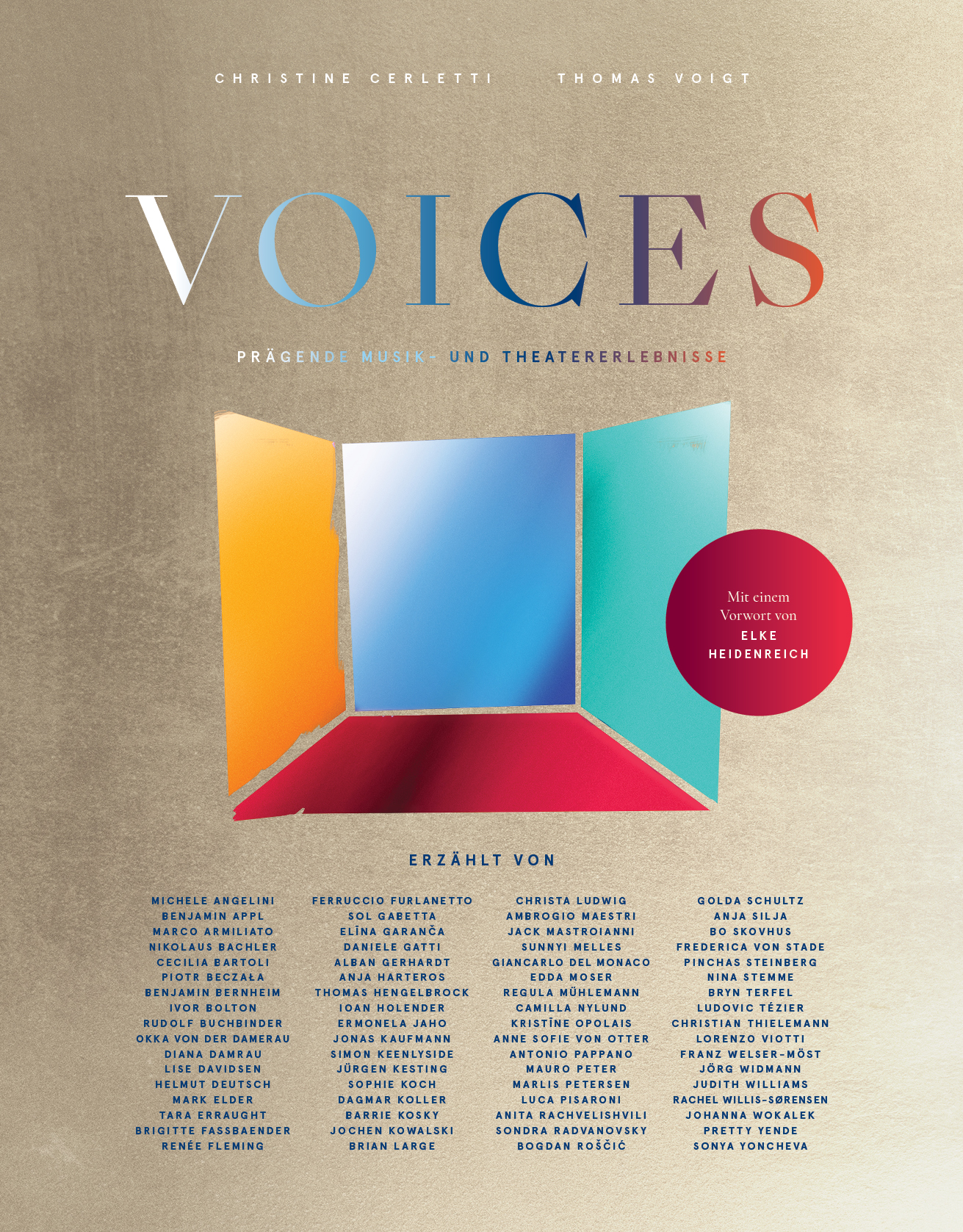Operndirigenten dürfen nicht eitel sein. Wirken sie doch meist im Inkognito: im dunklen Orchestergraben, wo sich dicht an dicht über hundert Musiker wie die viel zitierten Sardinen in der Dose drängen. Größte musikalische Intensität wird hier mit kleinsten nivellierten Gesten erzeugt – kein Ort für genialische Gebärden oder nonkonformistische Geister. Kaum einer weiß dies besser als Ivor Bolton: Seit seinem Debüt 1994 an der Bayerischen Staatsoper hat er rund 20 Neuinszenierungen gestemmt, darunter einen kompletten Monteverdi-Zyklus und zahlreiche Händel-Opern. Und eitel ist der Dirigent in der Tat nicht. „Ich stamme aus der englischen Arbeiterklasse. Mein Vater war Zugschaffner, meine Mutter Näherin.“
Der Dirgient schätzt die öffentliche Kulturförderung in Deutschland
In diesem sozialen Milieu ging es handfest zu, eine Laufbahn als Musiker war nicht vorgesehen. Doch Bolton hatte Glück, kam auf eine der kostenlosen Grammar Schools. „Ich erhielt eine humanistische Ausbildung, sang im Domchor, wir hatten einen wunderbaren Chorleiter“ – die Chance seines Lebens, die ihm später das Studium in Cambridge ermöglichte. So schimpft Bolton denn auch bis heute über die Sozialisten um Gordon Brown und Tony Blair, die jene Grammar Schools abschafften, „die Stupidifizierung der Masse“ gefördert und die „fatale Botschaft“ verbreitet hätten, klassische Musik und Oper seien „elitär und nur für reiche Leute“. Die englischen Politiker hätten nur einmal nach München blicken müssen, wo die Kultur nicht allein deutlich mehr öffentliche Subventionen erhalte als etwa in Paris oder London, sondern wo dies auch selbstverständlich sei. Die positive Folge: „In München oder Wien sieht man alte Menschen auf den ganz billigen Plätzen, die kommen mehrmals in der Woche. In London ist der Zugang zur Kunst wesentlich schwerer und kostspieliger; da sind die langen Wege, die teuren Taxis und Restaurants – wie soll man die Familie da nach Covent Garden ausführen?“
Von England über Salzburg nach Madrid
Ja, Bolton kennt sie gut, die englische Kulturlandschaft und ihre Nöte. 1984 hatte der ausgebildete Cembalist die St. James’s Baroque Players gegründet und mit seiner Frau, einer Musikwissenschaftlerin und Herausgeberin von Kirchenmusik, das Festival of Baroque Music ins Leben gerufen, zudem als Musikdirektor der Glyndebourne Touring Opera und Leiter des Scottish Chamber Orchestra gewirkt. Im Jahr 2000 wurde er fester Partner der Salzburger Festspiele, 2004 Leiter des Mozarteum-Orchesters. Eine erfolgreiche Liaison, an die sich 2016 ein neues Karrierekapitel anschießen wird, wenn Bolton an das Teatro Real in Madrid wechselt – und damit auch seinem Sommerhaus bei Granada in den Bergen näher kommt.
Doch jetzt geht es erst einmal nach Berlin, wo an der Staatsoper The Turn of the Screw auf dem Programm steht. Quasi Hausrepertoire für den Briten, der schon auf mehrere erfolgreiche Britten-Opern zurückblickt. Und wie ist das nun mit dem Unterschied zwischen Opern- und Konzert-Dirigenten? Bolton schmunzelt: Klar, in der Oper müsse man in ständiger Kommunikation mit der Bühne und den Sängern stehen, „alles muss sehr gut organisiert sein, man kann nicht plötzlich die Meinung ändern.“ Da habe er im Konzert natürlich mehr Freiheiten. Doch am Ende gelte schließlich hier wie da: „Gelingen muss es bei beiden.“