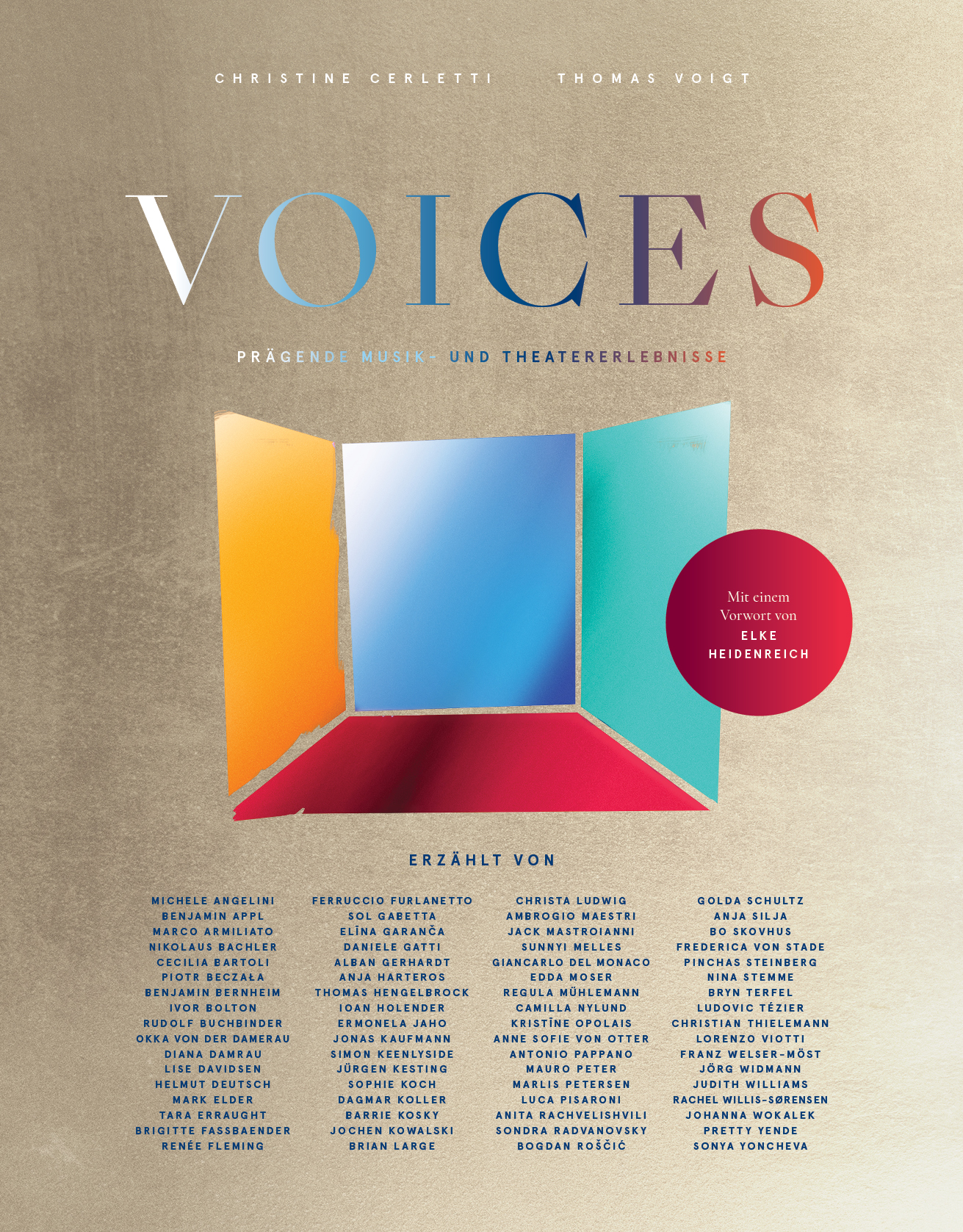Was einem an Jörg Widmann als erstes auffällt, ist die ungewöhnliche Ausstrahlung. Erlebt man Komponisten normalerweise als ruhige, nachdenkliche, gelegentlich etwas mürrische Gesprächspartner, so ist Widmann das komplette Gegenteil: unruhig, voller Inspiration, Kommunikations- und Tatendrang, er redet schnell, vieles sprudelt nur so aus ihm heraus. Man könnte dieses energische Auftreten mit seinem Alter begründen – Widmann gehört noch zur jungen Komponisten-Generation. Vermutlich hat es aber auch mit seiner Passion als Instrumentalist zu tun, die ihn stets vor einem zurückgezogenen Dasein im stillen Kämmerlein bewahrt hat.
1973 in München geboren, beginnt Widmann mit sieben Jahren, Klarinette zu spielen, und es dauert nicht lange, bis er anfängt, auf dem Instrument auch zu improvisieren. Schließlich kommt mit elf Jahren Kompositionsunterricht hinzu. Er erinnert sich an einen Walzer in F-Dur als erstes Werk, schon mit zwölf bekommt er eine Anfrage der Münchner Philharmoniker, für ein Kinderkonzert Variationen über Mozart zu schreiben. Die Studien weiten sich aus, Klarinette lernt er in München bei Gerd Starke, an der New Yorker Juilliard School bei Charles Neidich, Komposition studiert er bei Hans Werner Henze, Wilfried Hiller, Heiner Goebbels und Wolfgang Rihm.
Musik darf auch „furchtbar“ sein
Die Klarinette ist bei seinen ersten Kompositionen ein wichtiger Bestandteil, doch wendet er sich von Anfang an auch anderen Instrumenten und Kammerbesetzungen zu, komponiert bald Vokal- und Bühnenmusik sowie für Orchester. Dabei wird es mit zunehmender Werkzahl schwieriger, Widmann einzuordnen, in seinem heterogenen Schaffen einen gemeinsamen Nenner auszumachen. In jedem Fall lebt ein Großteil seiner Werke vom Ausforschen des jeweiligen Instruments. Seine „Fantasie für Klarinette“ (1993) ist eine Studie mit extremen Registern und anspruchsvoller Technik, die „Etüden für Solo-Violine“ (1995) setzen sich neben dem Thema Virtuosität vor allem mit den Resonanzmöglichkeiten des Instruments auseinander. Auch das Geräuschpotential der Singstimme lotet er aus („Signale“, 2003), ebenso des Klaviers, welches in Hallstudie (2003) von allen Seiten perkussiv bearbeitet wird.
Daneben experimentiert er auch mit Tonalem, verarbeitet Material von Beethoven und Schubert im „Jagdquartett“ (2003) und dem Orchesterwerk „Lied“ (2003). Doch auch hier überrascht und fordert er den Zuhörer, versagt ihm das Gewohnte. „Mir ist bewusst, dass ein Stück wie die Hallstudie für ein Abonnement-Publikum furchtbar sein kann – aber ich muss es eben schreiben. Das entsteht bei mir aus einer inneren Notwendigkeit heraus.“ Dabei zitiert Widmann auch gerne Schönbergs „Kunst kommt von Müssen.“
Der Erfolg gibt ihm Recht
Sein Erfolg spricht inzwischen für sich, seit Ende der 90er Jahre wird er mit Preisen ebenso überhäuft wie mit Kompositionsaufträgen, oft für großes Orchester. Warum es so gekommen ist, will oder kann er jedoch nicht beurteilen. „Ein Erfolgsrezept interessiert mich nicht. Ich würde auch jungen Komponisten nicht raten, den Erfolg berechnen zu wollen. Für mich hat das Komponieren mit Dingen wie Aufrichtigkeit zu tun, damit, dass man seinem Herzen folgt. Ich werde also nicht Takt 3 ändern, weil es dem Publikum nicht gefallen hat.“
Vorläufiger Höhepunkt war im Oktober 2012 die Uraufführung der Oper „Babylon“ an der Bayerischen Staatsoper. Eine Mammutproduktion mit exzentrischem Bühnenbild, schrillen Kostümen, Massenszenen und einem Libretto des Philosophen Peter Sloterdijk. Auch hier lieferte Widmann keinesfalls leichte Kost, er ließ unterschiedliche Musiksprachen aufeinanderprallen, erfand für die Sopranistin Anna Prohaska ungewöhnliche Artikulationen, schuf mit dem Orchester unerhörte Klangeffekte. Für die umfangreiche Partitur habe man sogar das Dirigierpult der Staatsoper vergrößern müssen, sagt Widmann.
Angesprochen auf das hohe Budget, das seine Oper verschlang, gibt er sich selbstbewusst, das Engagement für die Neue Musik sei heute nötiger denn je. „Für mich ist das eine existenzielle Kunstform. Dafür kämpfe ich auch, denn es scheint mir die große kulturpolitische Gefahr unserer Zeit zu sein, wenn nur noch das Quotendenken regiert, wenn immer erst gefragt wird ,wer will das hören’, anstatt dass man das Publikum fordert und dadurch ernst nimmt.“